INTEGRATIVE SCHULE |«Die Schule ist der integrativste Teil unserer Gesellschaft»
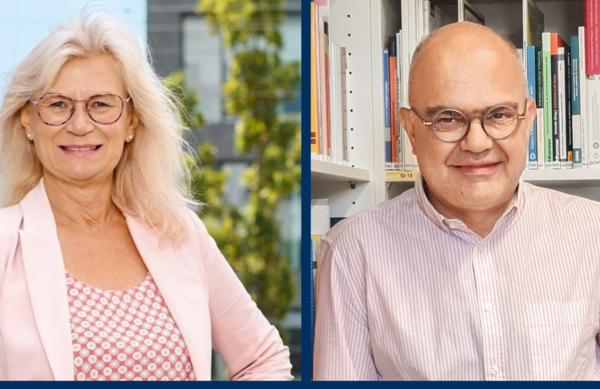
Die integrative Schule ist in der Lehrerschaft ein heiss diskutiertes Thema. Eine Mehrheit stehe dabei grundsätzlich hinter der Idee, sagt Dorothee Miyoshi vom Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Gemeinsam mit Romain Lanners, Direktor des Schweizer Zentrums für Heil- und Sonderpädagogik, debattiert sie über die Gelingensbedingungen der Schule für alle. Zukunftsweisend sei die Zusammenarbeit von Regel- und Sonderschulen.
Frau Miyoshi und Herr Lanners, wie halten Sie es mit der Terminologie: Bevorzugen Sie den Ausdruck integrative Schule oder reden Sie lieber von der inklusiven Schule? Oder haben Sie noch einen anderen Ausdruck?
Dorothee Miyoshi: In einem Positionspapier, das der Dachverband im letzten Jahr veröffentlicht hat, haben wir uns nach vielen Diskussionen auf den Ausdruck inklusionsorientierte Schule geeinigt, um zu verdeutlichen, dass Inklusion ein zielgerichteter Prozess ist und nicht als abgeschlossener Zustand verstanden werden kann. Eine grosse Herausforderung bedeutet es, dass die Kantone unterschiedliche Begriffe verwenden, um integrative oder inklusive Unterrichtsformen zu benennen und diese auch ganz unterschiedlich definieren. Ich bemängle diese Situation. Wenn wir schweizweit nicht vom Gleichen reden, ist es sehr schwierig, Erhebungen und Studien durchzuführen. Wir wissen deshalb auch nicht, wie die einzelnen Schulen die Integration umsetzen oder welche Ressourcen sie zur Verfügung haben.
Romain Lanners: Ob Integration und Inklusion das gleiche bedeuten oder eben nicht, ist für mich eine weitgehend theoretische Frage. Man könnte sagen, dass Inklusion weiter geht als Integration. «Inklusiv» heisst dann, dass alle Schülerinnen und Schüler in der gleichen Klasse sitzen. Und «integrativ» bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler das Schulgebäude teilen, aber nicht zwingend in der gleichen Klasse sein müssen, sondern entsprechend ihren Bedürfnissen in kleineren Klassen gefördert werden können. Diese Unterscheidung wird aber nicht von allen geteilt. Ich erachte es deshalb für sinnvoll, statt von Integration von einer Schule für alle zu reden. Dieser Ausdruck bringt Klarheit in die Diskussion.
Was bedeutet Schule für alle für Sie?
Lanners: Schule für alle bedeutet für mich, dass alle Schülerinnen und Schüler in die Schule ihres Wohnquartiers gehen und dort unterstützt werden. Und zwar mit unterschiedlichen Massnahmen: Kinder mit und ohne unterstützende Massnahmen besuchen ein- und dieselbe Klasse. Möglich ist aber auch, dass sie zum Beispiel im Rahmen einer Förderklasse separat unterstützt werden. Der Unterricht in der Regelklasse wird nicht allen Kindern mit speziellen Bedürfnissen gerecht. Wichtig ist meines Erachtens, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler in ihrem gewohnten sozialen Kontext bleiben können.
«Die Schule der Zukunft braucht Ideen und Konzepte, um mit einer immer heterogener werdenden Schülerschaft umgehen zu können.» Dorothee Miyoshi
Frau Miyoshi: Wie steht die Lehrerschaft zu dieser Vorstellung von integrativer Schule?
Miyoshi: Eine Mehrheit der Lehrerschaft kann sich eine Schule für alle, wie Romain Lanners sie gerade skizziert hat, vorstellen. Vonseiten des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz werden wir im September einen Bildungstag durchführen, bei dem es um diese Schule für alle geht. Es ist uns wichtig, dieses Thema öffentlich zu diskutieren. Im bereits erwähnten Positionspapier haben wir zu diesem Zweck auch unsere Forderungen und Anliegen an die Politik veröffentlicht, damit die inklusionsorientierte Schule gelingen kann.
Nicht alle Lehrerinnen und Lehrer begrüssen die integrative Schule respektive die Schule für alle. Können Sie das kurz erläutern?
Miyoshi: Die integrative respektive inklusionsorientierte Schule ist in der Lehrerschaft ein heiss diskutiertes Thema. Eine Mehrheit unserer rund 55 000 Mitglieder steht dabei grundsätzlich hinter der Idee, viele fühlen sich aber alleingelassen. Ganz wichtig aus Sicht der Lehrpersonen ist es, dass die Rahmenbedingungen vonseiten der Behörden so gestaltet sind, dass sie integrativ unterrichten können. Es braucht entsprechende Ressourcen und Instrumente. Es braucht auch die Möglichkeit verschiedener Settings, es können nicht immer alle Kinder in einer einzigen Klasse unterrichtet werden.
Wenn die integrative Schule heute mancherorts unter Beschuss gerät, hat das auch mit einem zu weit gehenden Verständnis der integrativen Schule zu tun?
Lanners: In der Diskussion wird Integration tatsächlich häufig falsch verstanden. Jeder und jede hat zum Thema eine eigene Meinung. Es wurde in der Vergangenheit aber auch schlecht kommuniziert, was Integration oder Inklusion tatsächlich bedeutet. Es gibt fälschlicherweise dieses Bild, dass alle Schülerinnen und Schüler in der gleichen Klasse sitzen müssen. Zahlreiche Kinder erhalten dadurch aber nicht die adäquate Antwort auf ihre Bedürfnisse. Ich denke hier an Schülerinnen und Schüler mit komplexen Beeinträchtigungen.
Miyoshi: Ich möchte betonen, dass heute in vielen Schulen sehr gute integrative Arbeit geleistet wird. Zu den Gelingensbedingungen gehören auf die Bedürfnisse zugeschnittene Schulsettings. Darüber hinaus haben solche Schulen auch entsprechende Ressourcen. Zudem brauchte es fähige und kreative Schulleitungen, welche die Schule für alle unterstützten und die Entwicklung mit ihrem Know-how vorantreiben. Erforderlich ist auch die entsprechende Haltung des Kollegiums, auch eine gute Infrastruktur. In den Schulen, wo das alles vorhanden ist, lassen sich die Herausforderungen gut meistern.
«Wenn wir eine Schule für alle wollen, dann müssen wir Regel- und Sonderschule zusammenbringen. Dies auch deshalb, weil zahlreiche Schülerinnen und Schüler nur vorübergehend auf separierende Strukturen angewiesen sind.» Romain Lanners
Lanners: Es ist in den vergangenen rund 20 Jahren sehr viel passiert. Wir haben als Folge der integrativen Förderung viel weniger Schülerinnen und Schüler in den Sonderklassen. Rund 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit einem besonderen Bildungsbedarf sind in einer Regelschule integriert, und davon besuchen 43 Prozent eine Regelklasse. Kritisch zu sehen ist aber die steigende Zahl von Schülerinnen und Schülern in den Sonderschulen.
Wie erklären Sie sich diesen steigenden Anteil von Schülerinnen und Schülern in den Sonderschulen?
Lanners: Da muss ich etwas ausholen: Im Unterschied zu unseren Nachbarländern haben wir eine lange Tradition der Separation in der Schweiz. Schon im 19. Jahrhundert wurden erste Sonderschulen und Sonderschulheime gebaut. Diese Bewegung wurde mit der Einführung der IV in den 60er-Jahren gestärkt. Der Bund investierte damals sehr viel Geld in die Sonderschulen. Wäre die IV etwas später gekommen, hätten wir in der Schweiz womöglich weniger Sonderschulen gebaut. Die Sonderschulen sind privatrechtlich und die Regelschulen öffentlich-rechtlich organisiert. Wir haben damit ein Zwei-Säulen-System geschaffen.
Und weshalb wächst trotz integrativen Bemühungen die Zahl der Sonderschulplätze in der Schweiz?
Lanners: Hier kommt Angebot und Nachfrage ins Spiel. Gerade in Kantonen mit einer starken Sonderschultradition werden Schülerinnen und Schüler, die aus den unterschiedlichsten Gründen in der Regelschule nicht mehr tragbar erscheinen, in einer Sonderschule begleitet. Man argumentiert damit, dass die Sonderschulen gut ausgerüstet sind, über die nötige Infrastruktur, das Fachwissen und die Ressourcen verfügen. Die Problematik dabei ist, dass die Re-Integration aus einer Sonderschule in die Regelschule nur sehr selten der Fall ist. Zudem kann sich die Regelschule nicht weiterentwickeln
Besteht damit das Risiko, dass Sonderschulen Ressourcen binden, auf welche die Regelschulen dringend angewiesen wären, um integrative Massnahmen erfolgreich umsetzen zu können?
Lanners: Die Kantone nutzen die vorhandenen Ressourcen sehr unterschiedlich. Der Anteil an Fachleuten, von der Logopädin bis zur Heil- oder Sonderpädagogin liegt in etlichen Kantonen bei bis zu 25 Prozent des Schulpersonals. Es gibt Kantone, die mit diesen Ressourcen integrativ unterwegs sind, andere hingegen separativ. Die Regelschule braucht Ressourcen für die Integration, Wenn wir eine Schule für alle wollen, dann müssen wir beide Systeme zusammenbringen. Dies auch deshalb, weil zahlreiche Schülerinnen und Schüler nur vorübergehend auf separierende Strukturen angewiesen sind, dies trifft vor allem auf Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten zu.
Miyoshi: Es ist wichtig, dass wir genügend Ressourcen für die Integration haben. Und ja, klar, wenn wir die beiden Säulen, Regel- und Sonderschulen, besser zusammenbringen könnten, wäre das ein sehr guter Ansatz. Zentral scheint mir darüber hinaus aber ein neues Denken in der ganzen Gesellschaft.
Können Sie diese Forderung konkretisieren?
Miyoshi: Wir befinden uns in einem gesamtgesellschaftlichen Wandel, der weit über die Schule hinaus geht. Die Schweiz bekennt sich in der Bundesverfassung sowie in einer Reihe von Gesetzen zu einer barrierefreien Gesellschaft. Sei dies im öffentlichen Verkehr, aber auch wenn es um die politische Teilhabe geht. Menschen mit Behinderungen sollen auch selbstbestimmt wohnen und arbeiten können.
Wenn es Probleme mit der integrativen Schule gibt, dann auch deshalb, weil wir als ganze Gesellschaft den geforderten Wandel noch zu wenig vollzogen haben?
Miyoshi: Ja, das sehe ich so. Ich würde behaupten, dass trotz gewissen Problemen die Schule heute sogar der integrativste Teil unserer Gesellschaft ist. Wir machen in der Schule die Herkulesarbeit im Bereich Integration. Es ist sehr einfach zu sagen, seht her, die Schule schafft es nicht, gehen wir wieder zurück zum alten System. Wir sollten stattdessen sagen, die Schule probiert diese schwierige Aufgabe zu lösen und das gelingt manchmal und manchmal auch nicht. Wir müssten uns fragen, was können wir tun, damit es besser gelingt.
Die Schule als Vorreiterin im Bereich Integration?
Lanners: Ihre Frage zielt darauf ab, ob wir zuerst eine inklusive Gesellschaft oder eine inklusive Schule brauchen. Ich glaube, wir brauchen beides. Wenn wir auf die inklusive Gesellschaft warten wollen, bis wir eine inklusive Schule realisieren, dann warten wir lange. Wenn wir hingegen in Richtung einer Schule für alle gehen, wird das auch die Gesellschaft beeinflussen. Die Schüler von heute sind die Erwachsenen von morgen. Wenn man den Umgang mit Heterogenität in der Schule lernt, dann weiss man auch, wie man später in der Gesellschaft damit umgehen kann.
Miyoshi: Die Schule leistet einen eminent wichtigen Beitrag für den sozialen Zusammenhalt unseres Landes. Das gelingt nicht mit Separation. Und ich finde, wie gesagt, dass das bereits auch sehr gut gelingt. Es ist wichtig, die Kinder an diese Denkweise heranzuführen. Ich arbeite in einer Integrationsklasse, und ich stelle fest, dass die Kinder sehr hilfsbereit sind und wichtige Erfahrungen machen können.
Um weiterzukommen mit der Schule für alle, müssen wir das Angebot der Sonderschule besser in die Regelschule bringen: Wie lässt sich das bewerkstelligen?
Miyoshi: Die Zusammenarbeit zwischen Regel- und Sonderschulen ist ein nächster Schritt in diesem grossen anspruchsvollen Projekt Integration. In den Schulen kommt das jetzt erst. Eine solche Zusammenarbeit stellt dabei die ganze Schulorganisation vor eine sehr grosse Herausforderung. Solche Prozesse brauchen sehr viel Zeit, das lässt sich nicht von heute auf morgen realisieren. Als Vision ist das sehr interessant, aber die Umsetzung ist enorm schwierig.
Lanners: Im deutschsprachigen Belgien hat man für die Zusammenführung zehn Jahre gebraucht. Sie haben dort ähnlich wie wir in der Schweiz auch ein Zwei-Säulen-System. Sie haben das jetzt so gemacht: Jede Gemeindeschule hat zwei Schulleiter, einen Sonderpädagogen oder eine Sonderpädagogin und eine Regelschulperson. Auch die einzelnen Klassen werden jeweils von einer Regel- und einer Förderlehrperson begleitet. Die Klassen vereinigen dabei immer zwei Jahrgänge, das Ziel wären drei Jahrgänge. Darüber hinaus bestehen auch Sonderklassen. Die enge Zusammenarbeit vor Ort führt dazu, dass es weniger Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf gibt, weil man früher eingreifen kann.
Gibt es Beispiele in der Schweiz?
Lanners: Genf hat diese Struktur auf der Grund- und Basisstufe aufgegriffen. In den altersdurchmischten Klassen gibt es je eine Fachperson der Sonderpädagogik und eine Regellehrperson. Das könnte ein Weg sein, um die Zusammenarbeit langsam aufzubauen. Das geht nicht von heute auf morgen, es braucht Vorbereitungsarbeiten, es braucht Aus- und Weiterbildungen, man muss die Eltern mit im Boot haben. Man muss auch die Gemeinde im Boot haben.
Miyoshi: Die Schule der Zukunft braucht Ideen und Konzepte, um mit einer immer heterogener werdenden Schülerschaft umgehen zu können. Wenn in einer Klasse eine Regelschul- und eine Sonderschullehrperson zusammenarbeiten, dann funktioniert tatsächlich die Prävention besser. Vonseiten der Lehrerverbands haben wir immer schon gefordert, dass in den Schulleitungen sonderpädagogisches Know-how vorhanden sein muss, das ist aber nicht überall umgesetzt. Ganz generell gibt es zu wenig sonderpädagogisches Fachwissen an den Schulen.
Was ist zu tun?
Miyoshi: Die entsprechende Ausbildung der Lehrpersonen ist hier sehr wichtig. Das ist aber alles andere als einfach. Im Rahmen des Bachelors an den PH ist es sehr schwierig, noch ein weiteres Thema aufzunehmen. Die Schweiz ist im Übrigen eines der wenigen Länder, das die Lehrpersonen nicht im Rahmen eines Masters ausbildet. Die Grundausbildung sollte in einem Bachelor geschehen, und hinterher sollten Vertiefungen im Rahmen eines Masters möglich sein, gerade auch in der Sonderpädagogik. Wir brauchen viel Know-how an den Schulen, das müsste man erkennen.
Lanners: Seit 100 Jahren haben wir getrennte Ausbildungen für Regelschul- und Sonderschullehrpersonen. Häufig fand und findet diese auch nicht am gleichen Ort statt. In der Zwischenzeit gibt es einige Pädagogische Hochschulen, wo die beiden Ausbildungsgänge am gleichen Ort durchgeführt werden. Dadurch besteht auch die Möglichkeit der Zusammenarbeit. Lehrpersonen waren lange Zeit Einzelkämpfer, das funktioniert nicht mehr. Um die Schule für alle zu realisieren, braucht es über die Ausbildung hinaus das Engagement aller Akteure, von der Politik und den Behörden über die Schulleitungen und die Lehrpersonen bis hin zu den Eltern. Jeder muss Schritte machen.
Miyoshi: Ich wünsche mir ein Bekenntnis aller Akteure zur integrativen Schule und integrativen Gesellschaft. Wir haben uns auch gesetzlich dazu verpflichtet. Der Grundsatz von Integration vor Separation ist im Sonderpädagogik-Konkordat so festgehalten. Die inklusive Bildung ist auch in der UN-Behindertenrechtskonvention, welche die Schweiz ratifiziert hat, ein wichtiges Thema. Dieses Bekenntnis scheint mir in der Gesellschaft noch zu schwach, wir brauchen ein klares Statement.
